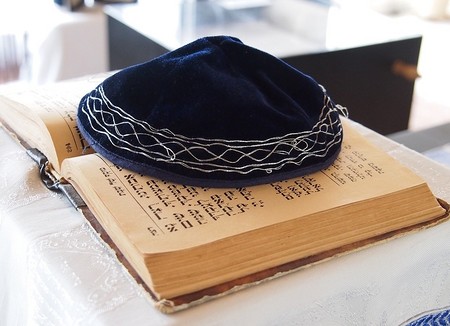Jäggle: "Gedenken ohne Lernen eröffnet keine Zukunft"
Eine positive Bilanz zum "Tag des Judentums" zieht der Präsident des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Prof. Martin Jäggle. Die Kirchen in Österreich begehen seit dem Jahr 2001 immer am 17. Jänner diesen "Tag des Judentums", mit dem deutlich werden soll, wie sehr das Christentum von seinem Selbstverständnis her mit dem Judentum verbunden ist. Zugleich soll auch das Unrecht an jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der Geschichte thematisiert werden. Inzwischen sei dieses Bewusstsein auch an der kirchlichen Basis angekommen, so die Bilanz Jäggles gegenüber Kathpress.
Dabei werde auch jüdische Unterstützung vermehrt gesucht und gefunden. Jäggle verwies auf den Wiener Rabbiner Schlomo Hofmeister, der vor kurzem betonte, dass der "Tag des Judentums" ein Geschenk sei. Freilich gelte es die, Beziehungen zum Judentum noch weiter zu intensivieren.
2019 führte der Koordinierungsausschuss gemeinsam mit Partnern eine Dreiteilung des "Tages des Judentums" ein; auf einen "Tag des Lernens", einen "Tag des Gedenkens" und einen "Tag des Feierns" (am eigentlichen "Tag des Judentums"/17. Jänner). Dies habe das Anliegen nochmals auf eine breitere Basis gestellt, so Jäggle: "Gedenken ohne Lernen eröffnet keine Zukunft." Der Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Bischof Tiran Petrosyan, wird mit einem Grußwort den "Tag des Lernens" (12. Jänner) im Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde Wien eröffnen.
Unbelehrbare kirchliche Gruppierungen
Allerdings gebe es auch unbelehrbare kirchliche Gruppierungen, die dem "Tag des Judentums" und dem damit verbundenen Anliegen immer noch keine Bedeutung zumessen wollten, räumte Jäggle ein. Zum Teil bediene man sich auch immer noch einer Sprache, die antijüdisch, ja teils antisemitisch ist. Fazit: "Es braucht einen langen Atem." Der Koordinierungsausschuss wird sich 2023 u.a. immer noch vorhandenen judenfeindlichen Darstellungen in Kirchen annehmen. Solche seien sogar noch nach 1945 entstanden, wie Jäggle sagte. "Wir versuchen, das auf eine konstruktive Weise zu thematisieren."
Positiv hob Jäggle im Blick auch das christlich-jüdische Verhältnis die kirchlichen Medien, aber auch die Universitäten hervor. In den Studienplänen der Katholisch-Theologischen Fakultäten und Hochschulen sei seit 2008 eine Lehrveranstaltung "Einführung in das Judentum" verpflichtend. Auch die "Theologischen Kurse" und die diözesanen katholischen Bildungswerke würden seit vielen Jahren Veranstaltungen und Spezialkurse zum Thema Judentum oder auch zum Thema Antisemitismus anbieten.
Der Präsident des Koordinierungsausschusses erinnerte zudem an das Gedenken im Blick auf 600 Jahre "Wiener Gesera" (1420/21). Die Wiener Theologische Fakultät war in die "Wiener Gesera", die Vernichtung der jüdischen Gemeinden im Herzogtum Österreich durch Herzog Albrecht V. 1420/21, involviert. Die Universität Wien gedachte gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien am 12. März 2021 dieses Massenmordes an der jüdischen Bevölkerung. Dabei habe die Katholisch-Theologische Fakultät ein Statement veröffentlicht, in dem sie der Opfer gedachte, ihre Mitverantwortung einbekannte und sich verpflichtete, "die theologische Auseinandersetzung mit dem Judentum und die Kooperation mit der jüdischen Gemeinschaft weiterhin zu fördern", wie Jäggle sagte.
Neue Forschungsergebnisse
Lobend erwähnte der Präsident des Koordinierungsausschusses im Kathpress-Interview das jüngste Buch des Wiener Bibelwissenschaftlers Markus Tiwald. In seinem Buch "Parting of the Ways" zeichnet Tiwald den komplexen und keineswegs geradlinig verlaufenden Prozess der Trennung von Judentum und Christentum nach. Ein Prozess, der "an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablief und nicht einmal durch die christologischen Fixierungen des vierten Jahrhunderts seinen endgültigen Abschluss fand", so Tiwald.
Auf rund 500 Seiten verdeutlicht der Neutestamentler, wie stark religiöse Motive im Frühjudentum und beginnenden Christentum sich durchmischten und wie wichtig das Wissen auch um die Geschichte des Judentums ist, um die Figur des Jesus von Nazareth ebenso wie Paulus, Petrus und andere Zentralgestalten des Christentums zu verstehen. "Jesus und seine ersten Nachfolger waren Juden - eine Glaubensgemeinschaft abseits des Judentums hatten sie nie intendiert", so Tiwald. Jäggle dazu: "Diese Erkenntnisse gilt es noch auf vielen theologischen und kirchlichen Ebene durchzubuchstabieren."
Zunehmende antisemitische Tendenzen
Besorgt zeigte sich Prof. Jäggle einmal mehr auch über zunehmende antisemitische Tendenzen in Österreich und ganz Europa. Der Koordinierungsausschuss werde immer wieder angefragt, hier aufklärend zu wirken. Jäggle erinnerte beispielsweise an die jüngste Antisemitismus-Debatte um einen "News"-Artikel über die psychologische Einschätzung der Kriegskontrahenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selensky. Jäggle hatte dazu im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ein Gutachten erstellt. Dass Selenskyj von einer Psychotherapeutin "in einer Art Ferndiagnose" als jüdischer "Vampir" bezeichnet wird (in der "News"-Titelstory "Die Psychologie der Macht" vom 15. April 2022), war laut dem Präsidenten des Koordinierungsausschusses "herabsetzend, beleidigend und durch seine jüdische Konnotierung antisemitisch". Der Artikel sei zugleich "hervorragend geeignet, die jahrhundertelange Anschuldigung, Juden und Jüdinnen benötigen Blut für religiöse Zwecke, wachzurufen". Dadurch sei er "als hochgradig antisemitisch zu bewerten", befand Jäggle. Das Gericht folgte seiner Argumentation.
25 Jahre Erklärung "Zeit zur Umkehr"
Prof. Jäggle wies im Kathpress-Interview auch auf zwei Jubiläen hin, die 2023 anstehen. Vor 25 Jahren verabschiedete die Evangelische Kirche in Österreich die Erklärung "Zeit zur Umkehr". In dieser räumte sie die Mitschuld der Christen und Kirchen am Leiden von Juden deutlich ein und verwarf zugleich die heftigen antijudaistischen Äußerungen Martin Luthers. Nur eine evangelisch-lutherische Landeskirche, nämlich jene von Hessen und Nassau in Deutschland, habe es 2014 den Evangelischen Kirchen in Österreich gleich getan, so Jäggle.
Kurt Schubert-Gedenken
2023 jährt sich zudem der 100. Geburtstag von Kurt Schubert (1923-2007). Aus diesem Anlass wird es am 28. März an der Universität Wien eine Festveranstaltung geben, kündigte Jäggle an. Details würden folgen.
Schubert wurde am 4. März 1923 in Wien geboren. Er setzte sich Zeit seines Lebens für einen verstärkten Dialog zwischen Christentum und Judentum ein und plädierte für eine verstärkte Einbeziehung der jüdischen religionswissenschaftlichen und kulturhistorischen Befunde in die christliche Theologie und Verkündigung. U.a. geht die Gründung eines eigenen Instituts für Judaistik an der Universität Wien auf seine Initiative zurück. Er starb am 4. Februar 2007.
Nicht zuletzt verdankt sich auch der Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit der Initiative Kurt Schuberts, denn Kardinal Franz König gründete diesen 1956 auf Anregung von Prof. Schubert. Der Ausschuss trug nach der Schoah wesentlich dazu bei, dass ein neues Verhältnis zwischen Judentum und Christentum in Österreich möglich wurde. Die Arbeitsbereiche sind Dialog, Bildung, öffentliche Kommunikation und Wissenschaft. Wie Prof. Jäggle sagte, sei das Vertrauen unter den Mitgliedern des Vorstands stark. Das zeige sich beispielsweise auch in persönlichen Einladungen zu religiösen Feiern im privaten Bereich.
Quelle: kathpress