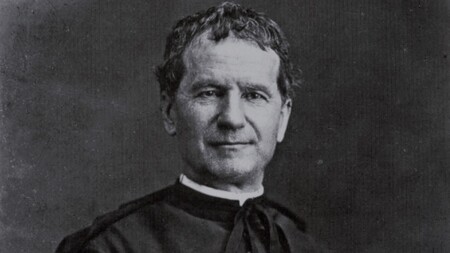Heilige Drei Könige
Am 6. Jänner feiert die katholische Kirche das Namensfest der Heiligen Drei Könige. Bis dahin ziehen tausende Kinder als Sternsinger von Haus zu Haus.
Am 6. Jänner feiert die katholische Kirche das Namensfest der Heiligen Drei Könige. Das Matthäus-Evangelium berichtet - je nach Übersetzung - von Weisen, Magiern oder Astrologen aus dem Osten, die einer Sternkonstellation folgend über Jerusalem nach Bethlehem kamen, um den neugeborenen König der Juden zu suchen.
In der Bibel heißt es:
Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten Gold, Weihrauch und Myrre als Gaben dar. (Mt 2,11)
Der Volksglauben machte aus den Magiern Könige verschiedener Erdteile und legte ihre Zahl in Anbindung an die Zahl der Geschenke auf drei fest. Seit dem sechsten Jahrhundert werden ihre Namen mit Caspar, Melchior und Balthasar angegeben. In der Kunst wird zumeist Caspar als Myrre schenkender Afrikaner, Melchior als Goldschätze überreichender Europäer und Balthasar als asiatischer König gezeigt, der Weihrauch zur Krippe bringt.
Nach einer Legende wurden die Gebeine der Heiligen Drei Könige zunächst in Konstantinopel aufbewahrt. Später sollen die sterblichen Überreste nach Mailand gelangt sein. Der Kölner Erzbischof und Reichskanzler von Kaiser Barbarossa, Rainald von Dassel, überführte die Gebeine 1164 als Kriegsbeute nach Köln. Der von Nikolaus von Verdun Anfang des 13. Jahrhunderts geschaffene und im Kölner Dom aufbewahrte Schrein gehört zu den wichtigsten Goldschmiedearbeiten des Mittelalters.
Die Heiligen Drei Könige werden als Schutzpatrone der Reisenden, Pilger, Kaufleute, Gastwirte und Kürschner verehrt. Seit dem Jahreswechsel 1965/55 organisiert die Katholische Jungschar die Sternsingeraktion. Kinder und Jugendliche in ganz Österreich bringen, als "Heilige Könige" gewandet, den weihnachtlichen Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Hilfsprojekte im Globalen Süden (mehr Infos auf www.sternsingen.at)
Brauchtum
Die Tradition des Sternsingens geht auf mittelalterliche Heischebräuche - also dem Bitten um Gaben - zurück. Es diente dazu, sich in der kalten Jahreszeit ein Zubrot zu verdienen. Im 20. Jahrhundert wurde dieser Brauch wiederbelebt. Heute sind es allerdings vorrangig Kinder und Jugendliche, die Jahr für Jahr zu tausenden von Haus zu Haus ziehen, für jene singen, die ihnen die Tür öffnen und Spenden sammeln für kinderbezogene Projekte in aller Welt. Bevor sie weiterziehen, schreiben sie meist mit Kreide verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl "C+M+B" auf den Türrstock. Es steht für „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne (dieses) Haus!“).